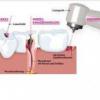Die Schüler gingen wie folgt vor:
Sie gaben einen Wassertropfen auf das Eukalyptusblatt und beobachteten unter dem Auflichtmikroskop, was mit dem Tropfen passierte. Danach strichen Sie die Hälfte der Oberfläche des Blattes leicht mit einem in Aceton oder Toluol getränkten Wattestäbchen ein. Weiters gaben Sie noch zusätzlich auf diese Hälfte wieder einen Tropfen und beobachten wieder, was passierte.
Der Wassertropfen auf der unbeschädigten Blattoberfläche bildete fast eine Kugel.
Nach der Zerstörung der Oberfläche bildete der Wassertropfen keine Kugel mehr und blieb auf der Oberfläche haften, egal wie man das Blatt hielt.
Die Erklärung dafür ist einfach:
Auf jedem Blatt befindet sich eine dünne Wachsschicht. Diese Wachsschicht bildet Mikrostrukturen, welche für den Lotus-Effekt verantwortlich sind. Der Wassertropfen schwebt sozusagen auf kleinen Luftpolstern und durch die Oberflächenspannung entsteht die kugelige Form. Doch durch das Aceton oder Toluol wird dieses Wachs heruntergewaschen. Dadurch verschwinden auch die Mikrostrukturen und das Wasser haftet aufgrund der größeren Adhäsionskräfte.
Die zweite Aufgabenstellung lautete: "Beobachte, was passiert, wenn ein Wassertropfen über eine mit Kreidestaub oder Toner beschmutzte Blattoberfläche eines Frauenmantels rollt."
Dazu streuten die Schüler etwas Toner oder Kreidestaub auf ein Blatt des Frauenmantels. Dann tropften sie einen einzelnen Wassertropfen auf das Blatt und als letzten Schritt kippten die Schüler dieses Blatt und beobachteten, was passierte.
Dieser Versuch funktionierte jedoch nicht bei jedem Schüler.
Grundsätzlich sollte der einzelne Tropfen beim Herunterrollen die Partikel der Kreide oder des Toners aufnehmen und eine Rinne hinterlassen. Die Kreide- und Tonerpartikel sollten von dem Tropfen aufgenommen werden, weil eine stärkere Adhäsion zwischen dem Wasser und dem Partikel herrscht, als zwischen dem Partikel und der Blattoberfläche. Doch manche Schüler bekamen nie einen richtigen Tropfen hin, darum probierten sie, wie leicht sich das Blatt reinigen ließ. Nach der Zerstörung der Oberfläche konnten sie es nicht mehr so gut reinigen, weil nun die Adhäsion zwischen dem Wasser und dem Partikel nicht mehr um so viel größer war, als die Adhäsion zwischen dem Partikel und der Oberfläche.
Diese Fähigkeit des Selbstreinigens ist wichtig, da sie der Pflanze hilft, frei von Schmutz zu bleiben, um so die ungestörte Fotosynthese zu ermöglichen.