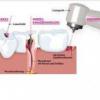Durchführung:
Ein Blatt wird mit Kreidestaub oder Toner bestäubt, dann mit der Spritzflasche gesäubert.
Die Oberflächenstruktur von einem anderen Blatt wird mit einer Bürste zerstört, dann wird es ebenfalls mit Kreidestaub bedeckt.
Beobachtung:
Der Wassertropfen rollt wie eine Kugel über das Blatt und nimmt dabei die Schmutzpartikel auf, eine saubere Spur wird hinterlassen. Das Blatt mit der zerstörten Mikrostruktur kann sich jedoch nicht mehr selbst reinigen.
Erklärung:
Da die Kreidepartikel hydrophil sind, werden sie vom Wassertropfen aufgenommen, bis dieser gesättigt ist. Deren Adhäsion zur Blattoberfläche ist geringer als die Adhäsion zum Wasser.
Die Fähigkeit zur Selbstreinigung spielt in der Natur eine wichtige Rolle, da nur saubere Blätter volle Funktionsfähigkeit zur Fotosynthese und zum Gasaustausch haben.
2. Versuch: Künstliche Herstellung einer hydrophilen Oberfläche
Durchführung:
Ein Objektträger wird erhitzt und wieder abgekühlt, danach wird ein Wassertropfen darauf gegeben. Zum Vergleich gibt man auf einen zweiten unerhitzten Objektträger auch einen Tropfen.
Beobachtung:
Ein deutlicher Unterschied ist zwischen den beiden Objektträgern erkennbar: Das Wasser breitet sich stärker auf dem erhitzten Objektträger aus, da die Verunreinigungen verbrannt sind und das Glas durch Oxidierung noch stärker hydrophil geworden ist.
3. Versuch: Künstliche Herstellung einer Oberfläche mit Lotuseffekt
Durchführung:
Der Objektträger wird erhitzt und mit Ruß bedeckt, um eine hydrophobe Oberfläche herzustellen.
Nun gibt man einen Wassertropfen auf die Oberfläche.
Beobachtung:
Die Tropfen prallen sofort ab und waschen dabei einige Rußpartikel ab.
Erklärung:
Im Kerzenwachs ist Paraffin enthalten, welches unverbrannt auf die Rußfläche kommt und eine stark wasserabstoßende Oberfläche erzeugt.